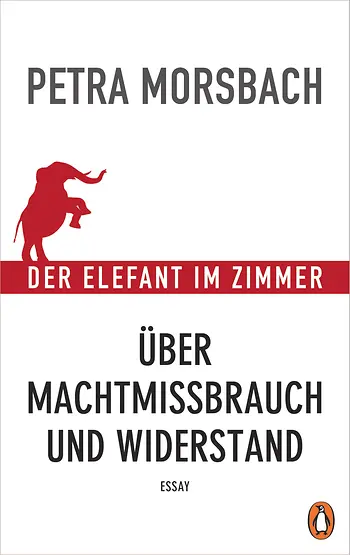Im Sommer 2025 erreichte die Redaktion eine Nachricht von Marie-Luise Conen mit Anmerkungen zu unserer bisherigen Timeline, ganz herzlichen Dank! Daraus ist nicht nur eine neue Rubrik „Geschichte der Systemik“ in unserem Blog entstanden, die unsere Timeline kritisch beleuchten, ergänzen und erweitern soll, sondern auch der vorliegende Beitrag von Frau Conen zur westdeutschen Frauenbewegung und Frauenforschung in der 1970er und 1980er Jahren. Wir freuen uns sehr über diese wertvollen Einblicke und Erläuterungen!
von Marie-Luise Conen
Vorab über mich aus dieser Zeit:
- 1975-1980 Studium der Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Berlin (1980 integriert in die TU Berlin), 1977/1978 Studium der Gruppendynamik/-beratung an der Temple University, Philadelphia.
- 1985-1987 Studium der Psychologie an der FU Berlin.
- 1978-1986 engagiert in der Frauenforschungsbewegung in der DGS und DGfE in Berlin.
- 1986 Beginn an den Arbeiten an meiner Dissertation (1990).
Zwischen Audrey Lord (1980er Jahre) und der Gründung des 1. Frauenhauses in Berlin (und damit die 1970er Jahre und anfänglichen 1980er Jahre) gibt es weitere wichtige Stationen bzw. Entwicklungen der westdeutschen Frauenforschung/-bewegung. Dazu möchte ich Folgendes erläutern:
Die Etablierung der feministischen Forschung in Berlin:
Ab 1978 kam eine Gruppe von Frauen, die an Frauenforschung und feministischer Theorie in Berlin interessiert waren, mehrmals im Jahr in den Räumen, in denen sich ab 1980 die neu geschaffene Zentraleinrichtung Frauenstudien und -forschung der FU Berlin befand, zusammen. Zu unserer Gruppe, die sich als Teil der DGS – Deutsche Gesellschaft für Soziologie – verstand, gehörten vorwiegend Soziologinnen oder, wie ich, einige Erziehungswissenschaftlerinnen u.ä.m. Sie kamen aus verschiedenen Wissenschaftszusammenhängen, wo sie an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen tätig waren, einige kamen auch aus der praktischen Arbeit mit Frauen
Führend in dieser Gruppe war Carol Hagemann-White, die damals bei den Soziologen der FU lehrte und 1976 habilitiert hatte. Auch andere Frauen promovierten entweder oder arbeiteten an ihren Habilitationen – und mussten dabei erhebliche Hindernisse meistern, um einen Lehrstuhl zu „erobern“. In diese Zeit fiel auch Carol Hagemann-Whites wissenschaftliche Begleitung des ersten Berliner Frauenhauses (1977-1980).
Die Berliner DGS-Frauen-Gruppe erwies sich als die einflussreichste und diskussionsfreudigste und ich erinnere gerne unsere Diskussionsrunden, die auch von strategischen Vorgehensweisen, um Fraueninteressen an verschiedenen Stellen einzubringen bzw. durchzusetzen, geprägt waren.
Carol Hagemann-White und auch andere Soziologinnen wie Ute Gerhard (Bremen, später dort Professur), Regina Becker-Schmidt (zunächst Hannover, später Institut für Sozialforschung Frankfurt/Main), Barbara Riedmüller (FU Berlin) und Ursula Beer (zunächst Bielefeld, dann Ruf nach Dortmund), um nur einige Namen zu nennen, trugen wesentlich dazu bei, dass Frauen- und Geschlechterforschung, einschließlich Studiengänge wie „Frauenstudien“ sich an den Hochschulen etablieren konnten.
In diesem Zusammenhang war von großer Bedeutung, dass es schließlich gelang, innerhalb der DGS eine eigene Sektion Frauenforschung (später: Frauen- und Geschlechterforschung) zu gründen, deren Sprecherin Carol Hagemann-White mit Gründung 1981-1983 war.
Kampf gegen Weiblichkeitsideologien und Aufbau der Sektion Frauenforschung:
In meinem Studium lasen wir die konservativen Konzepte zur Geschlechterordnung, in denen die Natur und Biologie das Wesen der Frau bestimmten, und unterzogen diese Ideologien in unseren Seminaren kritischen Analysen und Überlegungen. Die westdeutsche Frauenbewegung musste gegen diese Ideologien argumentieren, denn ihr ging es um die Selbstbestimmung und Autonomie der Frauen. Frauen wurden bis dato vorwiegend über ihre Männer definiert, was auch die Frauen selbst taten, weil sie diese Weiblichkeitsideologien verinnerlicht hatten. Es galt gegen diese Zuschreibungen des „weiblichen Sozialcharakters“ anzugehen, wobei jeder Schritt nach vorn mühsamst gegen das Desinteresse der Gesellschaft an einer Emanzipation von Frauen erkämpft werden musste. Der Rollback dazu begann bereits in den 1980er Jahren – bereits zu dieser Zeit war eine Fortschreibung der „weiblichen Normalbiografie“ zu verzeichnen. Der Frauenbewegung war klar, dass es immer wieder notwendig ist, Einfluss auf das gesellschaftliche Bewusstsein von Diskriminierung von Frauen zu nehmen, dies zu thematisieren und für Veränderungen zu kämpfen.
Die soziologisch geprägten Diskussionen in der DGS bezogen sich u.a. phasenweise schwerpunktmäßig auf die Diskriminierung von Frauen im Arbeitsleben und die Schwierigkeiten der Vereinbarung von Beruf und Privatem; dies erfolgte auf der Ebene von Forschungsfragestellungen und deren Erörterung. Das Leben vieler frauenbewegter Frauen war allerdings mehr von konkreten.
Die „Frauenszene“: Konkrete Lebensbereiche und das Thema Gewalt
Mitte/Ende der 1970er Jahre ging es in der westdeutschen Frauenbewegung weniger um die Erforschung als stärker um die praktische Veränderung in einzelnen Lebensbereichen.
Hier stand neben der „Abtreibungsdiskussion“ vor allem die Gewalt gegenüber Frauen im Mittelpunkt. Frauennotrufe, Walburgisnachtdemonstrationen (Take back the night), Gründung von Frauen-Cafés, Frauenbuchläden, Frauengesundheitszentren u. v. ä. m. bildeten sich überall, oftmals in Berlin (West) zuerst. Alice Schwarzer mit ihrer „Patriachats-Kritik“, aber vor allem mit ihrer Thematisierung von Abtreibungen, wurde zu einer der wichtigsten Frauenbewegerinnen, damals um den Preis als eine der am meisten gehassten Frauen in Deutschland betrachtet zu werden. Die von ihr gegründete Zeitschrift „Emma“ fand große Verbreitung nicht nur unter frauenbewegten Frauen. Sich autonom links-feministisch verstehende Frauen zogen ein Abonnement der Berliner Frauenzeitschrift „Courage“, die von 1976-1984 in –Berlin/West erschien, vor.
Das Tribunal über Gewalt gegen Frauen 1976 in Brüssel spielte in Bezug auf das Thema Gewalt gegen Frauen eine bedeutende Rolle und führte schließlich zur Gründung des ersten Berliner Frauenhauses 1976, das rasch „voll“ war und damit den hohen Bedarf an Angeboten dieser Art für Frauen zeigte.
Erziehungswissenschaftliche Perspektiven und der Einfluss der „Szene“:
Christina „Tina“ Thürmer-Rohr war ab 1972 Hochschullehrerin an der Pädagogischen Hochschule Berlin. Sie wurde später eine der einflussreichsten Theoretikerinnen des deutschen Feminismus und galt als unbequeme Denkerin. Sie griff Themen der „Szene“ auf und wirkte in diese Szene vielfach hinein. Sie war es, die ca. 1978 ein Theorie-Praxis-Seminar (TPS) zum Thema „Frauenhausarbeit“ anbot. Dieses Theorie-Praxis-Seminar war im Rahmen des progressiven Studienangebots an der PH Berlin Teil des Diplom-Pädagogik-Studiums und umfasste vier Semester nach dem Vordiplom. Studierende erschlossen sich in dem jeweiligen TPS-Schwerpunkt sowohl theoretisch als auch praktisch Kenntnisse und Erfahrungen. Studentinnen dieses Frauen-TPS waren zunächst ehrenamtlich im ersten Berliner Frauenhaus tätig, später einige davon hauptberuflich.
Ich persönlich – bei aller feministischer Orientierung – konnte mich damals diesem TPS nicht anschließen; die Diskussion, ob man dort mitarbeiten könne oder nicht, wenn man Partnerbeziehungen zu Männern unterhielt, schreckte mich ab. Andere, befreundete Studienkolleginnen, engagierten sich in großem Maße im Frauenhaus.
Diese Szene – Frauenarbeit/Mädchenarbeit – war es, die die konkreten Lebensbedingungen in Berlin und anderen Orten wesentlich zu beeinflussen suchte und dies mehr und mehr gelang. In dieser Frauen- und Mädchenarbeits-Szene, die in vielem ihre Anfänge in Berlin/West nahm, spielten zentrale Rollen Barbara Kavemann, Monika Savier und Carola Wildt, später u. a. in Köln Ursula Enders. Sie trugen mit zur Gründung von Beratungsstellen von sexuell missbrauchten Mädchen und Frauen bei (Wildwasser u. Zartbitter). Monika Saviers und Carola Wildts kleines Buch über „Mädchen zwischen Anpassung und Widerstand“ (1978), war – neben dem Taschenbuch von Ursula Scheu „Wir werden nicht als Mädchen geboren, wir werden dazu gemacht“ (1977) – damals eine Standardlektüre für jede frauenbewegte Frau.
Wissenschaftliche Verankerung in der DGfE und das Ringen um Anerkennung:
In der Frauen- und Mädchenarbeit gab es auch eine andere Gruppe, der ich ebenfalls eine Reihe von Jahren angehörte und die mich aktiv werden ließ. Denn es waren die Erziehungswissenschaftlerinnen, die sich – im Unterschied zu dem Schwerpunkt der meisten Soziologinnen – mehr mit der Erforschung der konkreten Arbeit mit Frauen und Mädchen beschäftigen wollten und die ebenfalls Wege suchten, sich organisiert als Wissenschaftlerinnen in die männerbeherrschte Hochschullandschaft der Pädagogik und Erziehungswissenschaften einzumischen.
Überregional trug vor allem Hannelore Faulstich-Wieland (später Hochschullehrerin in Frankfurt/Main und Hamburg) dazu bei, dass es schließlich eine Kommission Frauenforschung (später Frauen- und Geschlechterforschung) innerhalb der DGfE (Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften) gab. Hannelore Faulstich-Wieland hatte 1980 über „Berufsorientierte Beratung von Mädchen“ habilitiert.
1982 veranstaltete die DGfE-Kommission Frauenforschung ihr erstes Symposium zum Thema „Koedukation“ – denn die Frauenszene diskutierte in den 1970er- und 1980er Jahren auch die Nachteile einer Koedukation für Mädchen (und die Vorteile einer Mädchenpädagogik im Schulwesen). Andere Themen waren Mädchensozialisation und eben auch Gewalt gegen Frauen. In der DGfE waren namhafte Erziehungswissenschaftlerinnen engagiert wie Sigrid Metz-Göckel, die in Dortmund viel zur Gestaltung frauenspezifischer Themen im Lehrangebot beitrug. Ihr gelang es, den ersten Studiengang „Frauenstudien“ aufzubauen.
Des Weiteren waren Hedwig Ortmann (Bremen), Christine Holzkamp (PH Berlin), Gisela –Steppke (Berlin) Renate Thiersch (Tübingen) und Bärbel Schön (später Heidelberg) in der Kommission Frauenforschung engagiert und trugen ebenfalls zur weiteren Entwicklung der erziehungswissenschaftlichen Frauenforschung in Deutschland bei.
Frauen wie Helge Pross und Frigga Haug waren Vorreiterinnen für diese damals neue Frauen-Generation, gehörten aber nicht den o.g. Gruppierungen an. Helge Pross erhielt bereits 1965 einen Ruf als Professorin nach Gießen und fand großen Widerhall in der Öffentlichkeit über ihre Studie zu „Nur-Hausfrauen“. Frigga Haug kam aus der sozialistischen Frauenbewegung (Brot und Rosen). Sie stand der autonomen Frauenbewegung zunächst kritisch gegenüber und vertrat Positionen eines marxistischen Feminismus.
Die Treffen der DGfE-Frauen zeigten immer wieder, wie sehr frau mit den „üblichen“ männlichen Codes bei Bewerbungen auf Hochschulprofessuren zu kämpfen hatten. Nach und nach bildeten zahlreiche Frauen Netzwerke, um Frauen zu unterstützen auch innerhalb des Wissenschaftsbetriebes ihren Platz zu finden. Dies war bedeutend, denn eine Aufnahme in die DGfE konnte nur aufgrund einer Empfehlung eines Mitglieds erfolgen; dies machte auch mir eine Mitgliedschaft in der DGfE möglich.
Inzwischen sind in beiden Fachgesellschaften – Deutsche Gesellschaft für Soziologie und Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften – die Sektion bzw. Kommission „Frauen- und Geschlechterforschung“ nicht mehr wegzudenken, auch wenn man anfänglich dies als nur „vorübergehendes Thema“ betrachtete und daher in der DGfE erst 1991 – nach sieben Jahren Kampf darum – endlich dem Antrag auf Einrichtung einer Kommission Frauenforschung zustimmte.
Fazit: Wechselwirkungen, Errungenschaften und persönliche Umorientierung
Diese drei „Szenen“ – Soziologinnen, Erziehungswissenschaftlerinnen und „Frauenszene“ beeinflussten sich in großem Maße gegenseitig und haben erheblich dazu beigetragen, dass viele Rechte, Einordnungen und Möglichkeiten, die für heute jüngere Frauen selbstverständlich sind, gesellschaftlich stärker ihren Platz finden konnten – jedoch heute wieder bedroht sind.
Ich selbst interessierte mich zunehmend weniger für theoretische Diskurse, sondern mehr für die praktische Arbeit mit Mädchen, hatte ich doch im Rahmen eines Praktikums in einem US-amerikanischen Heim in Philadelphia mit jugendlichen Mädchen deren gewaltvolle Erfahrungen, insbesondere sexuellen Missbrauch mitbekommen. Zurück in Deutschland suchte ich Kontakte zur Frauenszene, die sich mit Mädchenheimerziehung beschäftigte, da ich zunehmend die Ursachen des Weglaufens von zu Hause in ihren Missbrauchserfahrungen sah – 1980 allerdings kein Thema in Deutschland. Von einer Dissertation zu diesem Themenkomplex sah ich dann später ab. Konkurrenzen und Machtkämpfe um Themensetzungen und Förderungen schreckten mich ab und ich beschloss dieses Themenfeld loszulassen.
Ich zog mich aus der Frauenszene zurück, eine Verbindung zwischen Familientherapie – die mich seit meiner Zeit in Philadelphia begeistert hat – und Frauenbewegung schien mir damals nicht (mehr) möglich. Sexuellen Missbrauch als Teil der Familiendynamik zu sehen – und Frauenarbeit schlossen sich für frauenbewegte Kolleginnen gegenseitig aus und damit für mich wichtige Denkweisen.
Späte Annäherung: Geschlechterrollen in der Familientherapie
Als das Buch „Unsichtbare Schlingen – Die Bedeutung der Geschlechterrollen in der Familientherapie“ von Marianne Walters, Betty Carter, Peggy Papp und Olga Silverstein (1991 auf Deutsch) und 1992 „Balanceakte. Familientherapie und Geschlechterrollen“ von Ingeborg Rücker-Embden-Jonasch und Andrea Ebbecke-Nohlen erschienen, empfand ich diese als kaum in Bezug zu diesen drei Frauen-Szenen. Ich hatte den Eindruck, dass frau sich sowohl recht spät als auch eher aus einer recht individuumsbezogenen Betrachtung heraus der Geschlechterdiskussion näherte, die wenig, ja kaum Bezüge zu der „Frauenszene/Frauenbewegung“ hatte.
Ich vermute, dass dieser mangelnde Bezug und auch eine fehlende Einbettung in die „Frauendiskussion“ u. a. mit dazu beigetragen haben, dass das Thema seitens der Frauen innerhalb der systemischen Fachverbände „verloren“ ging und von den männlichen Verbandsvertretern ignoriert wurde – obwohl der Anteil der weiblichen Mitglieder so deutlich herausragt – und erst seit kurzem erfreulicherweise Aufwind erfährt.