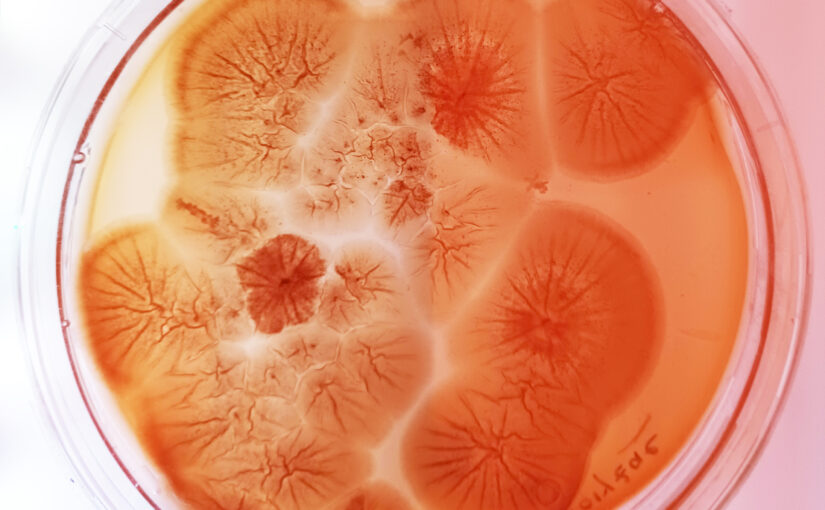Ingrid ist über 93 und allein. Sie fürchtet, sie wird nicht mehr lange so wie bisher in ihrer heiß geliebten Wohnung leben und sich um alle ihre Belange selber kümmern können. Sie wird abhängig von der Hilfe anderer sein. Und das hasst sie wie die Pest.
Sie, die immer eine sehr umgängliche, offene Frau war, fängt an, sich zu beklagen und alles abzulehnen, was ihr helfen könnte. Sie sagt: „Es fällt mir so schwer, ‚nein‘ zu sagen, und das einzige Mal, als ich es getan habe, habe ich es teuer bezahlt. Ich befürchte, dass andere über mich bestimmen, wenn ich mir helfen lasse.“
Ingrid wuchs mit drei Geschwistern in einem Arbeiterviertel auf. Nächtelang mussten sie im Hausflur ausharren, wenn der volltrunkene Vater wieder einmal die Kinder und ihre Mutter verprügelt und dann hinausgeworfen hatte. Schließlich wurde Ingrid von der Fürsorge aus der Familie genommen und auf einen Bauernhof verfrachtet, auf dem sie als billige Arbeitskraft ausgenutzt wurde. Nach dem Ende von Krieg und Nationalsozialismus konnte sie es kaum glauben, dass es einen Mann gab, der sie heiraten wollte. Sie bekam zwei Töchter. Sie passte sich sehr an, und mit den Jahren begegnete ihr Mann ihr mit immer größerer Verachtung. Als ihre Töchter am Beginn ihrer Pubertät waren, halfen sie ihrer Mutter dabei, ihren Mann mit größerer innerer Distanz zu sehen. Doch für Ingrid gab es kein anderes Lebensmodell.
Die Jahre vergingen, und eines Tages kam sie an einem Gebäude vorbei, an dessen Tür das Schild „Eheberatungsstelle“ hing. Und da fing es in ihr an zu arbeiten. Als der Vorsatz herangereift war, ging sie zu einer Beratung durch diese Tür. Im Laufe des Gesprächs fragte die Beraterin sie: „Haben Sie schon mal an Scheidung gedacht?“ – „Nein!“ entfuhr es ihr. Das hatte sie nie als Möglichkeit für sich gesehen. Sie ging nach Hause, und es arbeitete wieder in ihr. Sie kämpfte einen jahrelangen, inneren Kampf.
Eines Tages, die Töchter waren erwachsen und ausgezogen und der Mann war mal wieder „zur Kur“, nahm sie ihre Siebensachen und zog aus. Sie hatte alles gut vorbereitet. Von da an genoss sie ihr Alleinsein in vollen Zügen – wenn die Sonne in ihr Zimmer schien oder wenn sie im Schwimmbad ihren Körper im Wasser er-leben konnte. Sie arbeitete als Putzfrau, da sie keine Ausbildung hatte. Sie besuchte Bildungsveranstaltungen und lernte andere Frauen ihres Alters kennen, mit denen sie sich offen und ehrlich austauschen konnte. Und so wurde sie alt.
Mit Mitte 80 wurde sie sehr krank und musste im Krankenhaus behandelt werden, doch sie erholte sich wieder. Ihre Tochter bat sie, zu ihr in die Schweiz zu ziehen, sie würde ihr ganz in ihrer Nähe eine kleine Wohnung suchen. Ingrid konnte sich nicht vorstellen, woanders als dort zu leben, so sie ihr ganzes Leben verbracht hatte, und so sagte sie „nein“. Da brach ihre Tochter den Kontakt zu ihr ab. Die andere Tochter solidarisierte sich mit ihrer Schwester und beendete ebenfalls den Kontakt zu ihrer Mutter. Ingrid verstand die Welt nicht mehr. Aber sie gab nicht nach, und ist nun allein.
Ingrid ist keine Heldin, und dennoch bewundernswert. So wenig Türen, die ihr offen standen, doch als sie einmal erfahren hatte, wie sich ihr Leben „richtig“ anfühlt, hatte sie mit Mitte 50 den Mut, diesem Kompass zu folgen. Sie brauchte viel Zeit, um herauszufinden, was „richtig“ für sie hieß. Wäre sie bei uns in der Beratung oder Therapie – könnten wir aushalten, wenn sie als Klientin keine „Aha-Momente“ hätte, sondern „das Richtige“ sich nach und nach anschleicht und Gestalt annimmt? Ich bin immer wieder fasziniert davon, wenn die „Aha-Erlebnisse“ sich so völlig unverhofft ergeben, mal plötzlich, mal nach und nach, kaum merklich, sich entwickelnd. Und wenn dieses Erleben dann die Kraft entfaltet, Ängste und Unsicherheiten oder Gewohnheiten wie Seifenblasen zerplatzen zu lassen.
Ihr könnt den Blog abonnieren, indem ihr hier eure Mailadresse eintragt. Sie wird ausschließlich dafür verwendet, euch zu informieren, wenn ein neuer Beitrag online gestellt wurde.
Wir freuen uns, wenn ihr unsere Beiträge lest, teilt, kommentiert und unser Blog-Projekt verfolgt und unterstützt.