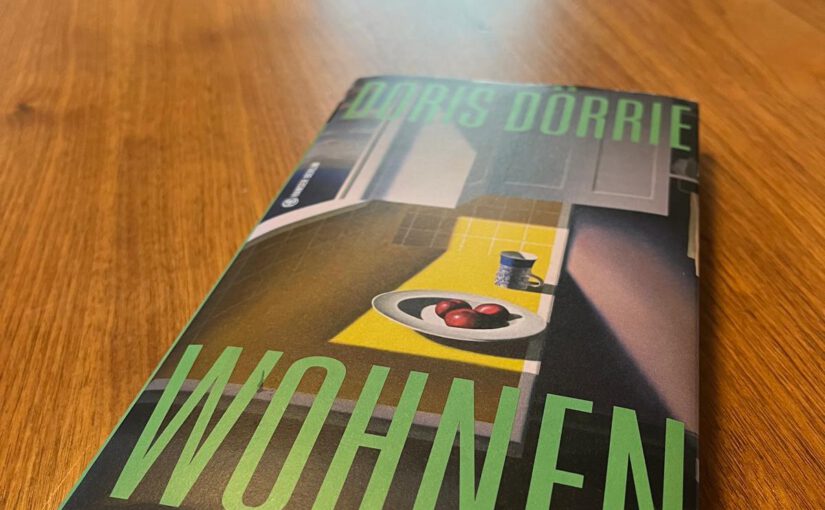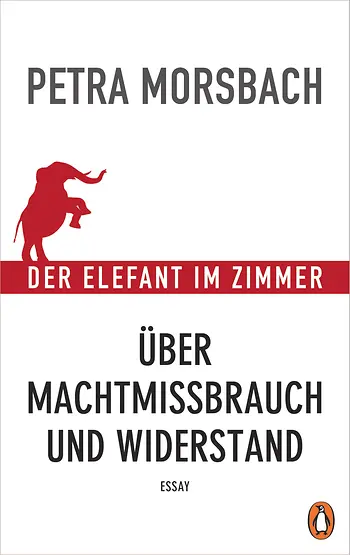Am 3. Januar 2025 hat Gila Klindworth hier auf unserem Blog den Beitrag „Wo stehen wir eigentlich mit der Gleichheit in der Kommunikation zwischen den Geschlechtern?“ veröffentlicht. Ich lese ihn – und merke, dass er etwas in mir auslöst.
Ja, wir haben viel erreicht. Ja, wir haben gelernt, anders über Geschlechterrollen zu sprechen. Ja, wir wissen um die Mechanismen, die unsere Kommunikation prägen. Und doch bleibt ein Gefühl der Schwere.
Es ist, als ob ich nie einfach nur sein kann. Ein ständiges Bewusstsein darüber, welche Strukturen wirken, welche Rollen wir einnehmen, welche Erwartungen auf uns lasten. Selbst bei Dingen, die mir eigentlich leichtfallen, taucht ein Hinterfragen auf. Wenn ich gerne plane, gerne organisiere, gerne die Verantwortung für das große Ganze übernehme – ist das dann meine Kompetenz oder meine Sozialisation? Und warum wird diese Frage überhaupt so wichtig?
Und dann gibt es noch einen anderen Druck. Den Druck, alles zu bewältigen. Viele Frauen tragen eine doppelte Last: Sie wollen ihre beruflichen Ziele verfolgen, wirtschaftlich unabhängig sein, sich verwirklichen – und gleichzeitig gute Mütter, Partnerinnen, Freundinnen sein. Sie wollen alte Muster aufbrechen und sich von klassischen Rollenbildern lösen – und merken doch, dass gerade dieser Anspruch neue Anforderungen schafft.
Das Bild der Frau, die „alles schafft“, die Kinder und Karriere unter einen Hut bekommt, die sich zwischen den Welten bewegt, ohne ins Straucheln zu geraten – ist das nicht auch ein Narrativ, das uns formt? Eine neue Norm, die uns antreibt, aber auch auslaugt?
Es ist ein Paradox: Wir kämpfen gegen traditionelle Rollenzuschreibungen, nur um uns in neuen Anforderungen wiederzufinden. Wer als Frau sichtbar sein will, wer sich in der Arbeitswelt behauptet, muss oft noch einmal mehr leisten. Muss beweisen, dass es geht – und dass es gleichzeitig keine Schwäche bedeutet, Fürsorge und Verantwortung im Privaten zu übernehmen.
Das ist keine individuelle Erfahrung, sondern ein kollektives Muster. In der therapeutischen Arbeit zeigt sich diese Zerrissenheit häufig. Frauen berichten von Erschöpfung, von dem Gefühl, niemals genug zu sein – weder im Beruf noch in der Familie. Und selbst wenn sie sich bewusst gegen bestimmte Rollenerwartungen entscheiden, bleibt oft die Frage: Habe ich damit wirklich eine freie Wahl getroffen – oder ist es nur eine andere Version dessen, was von mir erwartet wird?
Dieser Druck, alles zu hinterfragen, alles zu leisten, alles zu vereinen, macht es schwer, sich einfach nur zu spüren. Ihn loszulassen ist nicht einfach – aber vielleicht wäre genau das manchmal die eigentliche Befreiung.
Zwischen Bewusstsein und Selbstzweifel
Gila Klindworth schreibt darüber, wie sich alte Muster in Beratungssituationen zeigen. Frauen, die als fordernd wahrgenommen werden, während Männer in der passiven Rolle oft weniger Widerstand erfahren. Ich kenne diese Dynamiken. Ich sehe sie. Ich analysiere sie. Und oft frage ich mich: Wie tief sind sie eigentlich in uns verankert?
Es gibt ein gesellschaftliches Bewusstsein für Ungleichheiten, das gewachsen ist. Viele Menschen wollen reflektiert handeln, sich von tradierten Rollenbildern lösen. Und doch bedeutet dieses Bewusstsein nicht automatisch, dass wir frei von diesen Strukturen sind. Vielmehr scheint es manchmal, als hätten wir sie einfach auf einer anderen Ebene internalisiert.
Der Druck kommt längst nicht mehr nur von außen. Er kommt auch von innen. Von der Stimme, die mahnt, ob ich mich gerade unbewusst einer alten Norm anpasse. Von dem Gedanken, dass mein Verhalten nicht nur für mich spricht, sondern auch für ein größeres Ganzes. Als würde ich nicht nur für mich selbst handeln, sondern auch für das Bild der modernen Frau, der feministischen Frau, der reflektierten Frau.
Es ist ein Drahtseilakt zwischen Bewusstsein und Selbstzweifel. Denn wer einmal erkannt hat, wie stark soziale Prägungen wirken, kann sie nicht mehr übersehen. Die Frage, ob ich mich aus freien Stücken so verhalte oder ob es doch ein Produkt meiner Sozialisation ist, wird zu einem ständigen Begleiter. Und wenn alles hinterfragt wird, dann bleibt irgendwann kaum noch Raum für ein ungefiltertes, intuitives Ich.
Was als Befreiung begann – das Lösen von alten Geschlechterrollen, das Streben nach Gleichheit – droht an einem Punkt zur nächsten Anforderung zu werden. Es reicht nicht mehr, bewusst zu sein. Es muss das richtige Bewusstsein sein. Die richtigen Entscheidungen. Das richtige Maß an Reflexion.
Feminismus war einmal ein Kampf um Freiheiten. Doch immer häufiger fühlt er sich an wie eine weitere Leistung, die zu erbringen ist. Eine neue Form der Perfektion, in der es nicht darum geht, einfach zu sein, sondern darum, sich konstant zu hinterfragen, zu optimieren, zu dekonstruieren.
Wann wurde das Hinterfragen von Geschlechterrollen zu einer Aufgabe, die ich möglichst konsequent und fehlerfrei bewältigen sollte?
Wann wurde Feminismus zu einem Maßstab, an dem ich mich selbst messen muss?
Und wo bleibt in all dem die Freiheit, mich einfach zu spüren – ohne mich gleichzeitig zu analysieren?
Die Erschöpfung, die keiner benennt
Vielleicht geht es nicht nur darum, zu erkennen, wo sich alte Muster fortsetzen. Vielleicht liegt eine der größten Herausforderungen darin, uns nicht selbst in einer Spirale des ständigen Hinterfragens zu verlieren.
Ja, wir brauchen ein Bewusstsein für Ungleichheiten.
Ja, es ist wichtig, Kommunikation und Machtstrukturen zu hinterfragen.
Ja, feministische Arbeit hat viel verändert.
Aber wie viel Reflexion ist genug? Wo ist der Punkt erreicht, an dem Bewusstsein nicht mehr zur Befreiung, sondern zur Belastung wird?
Es ist eine feine Grenze. Die Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen, mit Strukturen, mit Machtmechanismen ist notwendig – aber sie hinterlässt auch Spuren. Wer sich immer wieder bewusst macht, welche Dynamiken wirken, bleibt in einem Zustand der Wachsamkeit. Das kann stärken, es kann aber auch ermüden. Es kann das Gefühl erzeugen, dass nichts mehr einfach nur ist, sondern alles eine Bedeutungsebene hat, die analysiert und bewertet werden muss.
In der therapeutischen Arbeit zeigt sich diese Erschöpfung oft. Viele Frauen erleben ein permanentes Spannungsfeld zwischen dem Anspruch, sich von traditionellen Rollen zu lösen, und der subtilen Erwartung, es dabei richtig zu machen. Die Vorstellung von Freiheit wird dadurch zur nächsten Aufgabe: nicht nur selbstbestimmt, sondern auch konsequent reflektiert, dekonstruierend, möglichst fehlerfrei.
Aber wäre es nicht genauso revolutionär, sich manchmal zurückzulehnen? Nicht alles zu dekonstruieren? Nicht jeden Moment mit Selbstprüfung zu füllen?
Gila Klindworth fragt: „Wo bleibt die Macht? Wer setzt sie wie ein?“
Ich frage: Wo bleibt die Leichtigkeit? Wo bleibt der Raum, in dem wir einfach da sein dürfen – ohne den ständigen Impuls, unser Verhalten aus allen Perspektiven zu hinterfragen?
Vielleicht liegt die Antwort nicht im unaufhörlichen Analysieren, sondern im Vertrauen darauf, dass wir nicht immer alles perfekt machen müssen. Dass wir Fehler machen dürfen. Dass wir Entscheidungen treffen können, ohne sie sofort in ein größeres gesellschaftliches Narrativ einzuordnen. Dass wir uns in unserer Widersprüchlichkeit aushalten können – ohne den Druck, sie sofort auflösen zu müssen.
Ich weiß nicht, ob das eine „richtige“ Antwort ist. Aber vielleicht muss es auch gar keine geben. Vielleicht reicht es manchmal, einfach zu spüren, was gerade da ist – ohne es sofort zu bewerten.