Eigentlich hatte ich vor, in diesem Text einen Konflikt an meinem Arbeitsplatz und meine Beobachtungen zu Interaktionen zwischen Frauen und Männern zu schildern. Doch: nur beim Daran denken verging mir schon die Lust. In mir sperrte sich etwas, mich erneut in den Ärger und das Ohnmachtsgefühl, das mich begleitete und immer noch nicht ganz loslässt, hineinzubegeben. Ich entschied mich letztendlich für einen ressourcenorientierten Zugang und schreibe nun über das, was nützlich war.
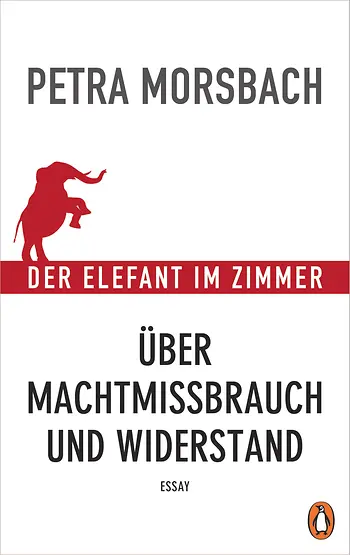
Das Buch „Der Elefant im Zimmer“ von Petra Morsbach (empfohlen von einer geschätzten Kollegin) half mir in dieser Situation nicht das erste Mal aus einer inneren Zwickmühle. Die Autorin beschreibt ausführlich drei Fälle, in denen die Beteiligten (im letzten Fall auch sie selbst) mit den „Mächtigen“ in Konflikt gerieten.
Die Idee entstand aus der eigenen Erfahrung sowie dem Austausch mit Kolleg*innen und Bekannten. Während letzterem entstand bei ihr der Eindruck, dass Konflikte mit „Mächtigen“ nach ähnlichen Mustern abzulaufen scheinen:
- Angehörige eines Systems wehrten sich gegen eine problematisch Anweisung oder wiesen auf Fehler hin, in der Erwartung von Abhilfe.
- Vorgesetzte ignorierten den Hinweis oder ließen diesen nach einer Scheindiskussion versanden.
- Nachhaken führte ironischem Entgegenkommen, Spott, Einschüchterungsversuche, Drohungen und Disziplinarmaßnahmen.
- Wenn die Kritik am Chef als Kritik an der Institution gesehen wurde, richtete sich die Stimmung der Belegschaft gegen die Kritiker*innen, Solidarität verschwand.
- Korrekturen gab es wenn überhaupt nach schweren Schäden, Skandalen oder Sanktionen.
Morsbach geht mit Hilfe ihrer drei Beispiele von „Widerstand gegen Machtmissbrauch“ auf eine „literarische Erkundungstour“.
Ihre These: Die Verleugnung der Macht (des Elefanten im Raum) ist das Kernproblem. Liegt bei Personen, die Macht in Institutionen innehaben, eine Kombination aus Machtorientierung (also eines Strebens nach Selbstaufwertung und Anerkennung durch diese Position) UND Machtleugnung, mit der individuelle Verantwortung zurückgewiesen wird („Ich kann da nichts machen.“) vor, entsteht ein Paradoxon, das schwer aufzulösen ist. Weiterhin bemerkt sie, komme erschwerend hinzu, dass jede Person, die das Problem im Verlauf „unwidersprochen hinnimmt, wird zum Komplizen und muss sich angegriffen fühlen, wenn es auf den Tisch kommt.“
Die Autorin legt in ihren Ausführungen den Fokus auf die Dynamiken, die auf die Aufdeckung des Problems folgen, beleuchtet die Sprache, in der die Konflikte geführt wurden, und möchte tiefer liegende (unbewusste) Motive explorieren.
Ihre Frage: Können „Unmächtige“ mit legalen Mitteln Machtmissbrauch praktisch abhelfen? Und wenn ja wie? Ihre Antwort im Nachwort: Jein. „Eigentlich nicht, aber sie sollten es trotzdem versuchen, denn das bewirkt etwas.“
Auch wenn die Konflikte mit „Mächtigen“, in denen ich beteiligt war, nicht ganz diesem Muster entsprachen, erleichterte es mich ungemein, dass es sich anscheinend um eine geteilte Erfahrung handelt. Das Buch gab mir die Chance, sprachliche Muster abzugleichen und in den „Machtkontext“ einzuordnen, auch wenn meine Beispiele in vergleichsweise kleineren Organisationseinheiten stattfanden. Ich fühlte mich dann nicht mehr so ohnmächtig. Eine schöne Erkenntnis war auch, Unterschiede in den Mustern zu entdecken. Ich war zum Glück nie allein als Kritikerin, sondern Teil einer Gruppe und die Solidarität untereinander blieb uns auch erhalten. Es war vor allem eine Solidarität unter Frauen, die sich männlich besetzten Machtstrukturen entgegensetzte. Und: Auch machte ich die Erfahrung, die die Autorin mit „Eigentlich nein, aber sie wollten es trotzdem versuchen, es bewirkt etwas.“ beschrieb. Ich beobachtete oft kleine, manchmal auch größere Veränderungen, die vielleicht in dieser Dosis und/oder nach etwas verstrichener Zeit für das System verträglich erschienen.
Morsbachs Buch ist für mich einfach gute Unterhaltung, weil die Autorin mich mit ihrem persönlich wirkenden Schreibstil in den Bann gezogen hat. Darüber hinaus gibt sie mit dem Buch die Chance, sich mit bestimmten Mechanismen der Macht vertraut zu machen, und stellt am Ende einen Katalog mit 33 Empfehlungen und Überlegungen zur Verfügung, von denen viele in unterschiedlichsten Konflikten anwendbar erscheinen.
Ich möchte den Text mit einem Gedanken der Autorin beenden, der auf die zirkulären Wirkmechanismen in diesen Konflikten eingeht und mich auch immer wieder etwas demütig werden lässt. Sie kommentiert die Dynamik zwischen den Machausübenden und den Kritiker*innen mit folgenden Fragen: „Sind nicht auch sie in Wechselwirkung aufeinander bezogen? Spielt jeder nur eine Rolle in einem größeren Spiel, das er nicht überblickt? Wer hat recht? Wer entscheidet das? Wer verteilt die Rollen?“